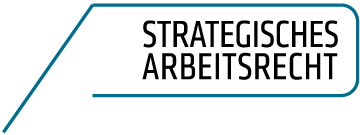Tipp Nr. 75: Zeugnis: Gestaltung der Leistungsbewertung
Ist ein Arbeitnehmer mit der Bewertung seiner Leistung in einem Zeugnis nicht einverstanden, hat er arbeitsrechtlich die Möglichkeit, gerichtlich einen Anspruch auf Zeugnisberichtigung zu verfolgen.