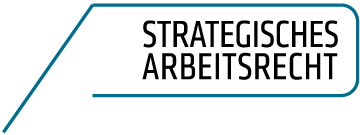Scheidet ein Arbeitnehmer bei einem Arbeitgeber aus dem Arbeitsverhältnis aus, ist er rechtlich nicht gehindert, mit einem Arbeitgeber, der mit seinem bisherigen Arbeitgeber im Wettbewerb steht, einen Arbeitsvertrag abzuschließen. Ein Arbeitgeber, der erreichen will, dass ein bei ihm tätiger Arbeitnehmer nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses zumindest für eine gewisse Zeit nicht zu einem Konkurrenzunternehmen geht oder ihm als Selbstständiger Konkurrenz macht, muss mit dem betreffenden Arbeitnehmer unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben der §§ 74 ff. HGB ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot vereinbaren. Für die Dauer des nachvertraglichen Wettbewerbsverbotes – dieses kann höchstens für zwei Jahre abgeschlossen werden – hat der bisherige Arbeitgeber als Entschädigung nach § 74 Abs. 2 HGB mindestens die Hälfte der vom Arbeitnehmer bisher bezogenen vertragsmäßigen Leistungen zu zahlen. Hat ein Arbeitgeber mit einem Arbeitnehmer erst einmal ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot abgeschlossen, kann er sich nicht ohne Weiteres von diesem wieder lösen. Er kann grundsätzlich lediglich nach § 75a HGB vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses auf dieses nachvertragliche Wettbewerbsverbot durch schriftliche Erklärung verzichten. Der Arbeitgeber wird dann aber erst mit Ablauf eines Jahres seit der Erklärung von der Verpflichtung zur Zahlung der oben genannten Entschädigung frei. Der Arbeitnehmer hingegen kann sogleich nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses bei einem Konkurrenzunternehmen beginnen, da das nachvertragliche Wettbewerbsverbot für ihn ab dem Zugang der Verzichtserklärung nicht mehr gilt.
Die falsche Strategie
Ein Arbeitgeber schließt ohne weitere Überlegungen mit einem neuen Arbeitnehmer nicht nur einen Arbeitsvertrag ab, sondern vereinbart auch ab dem ersten Tag des Arbeitsverhältnisses ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot. Scheidet der Arbeitnehmer dann nach kurzer Zeit aus dem Arbeitsverhältnis aus, weil der Arbeitgeber ihn z. B. aufgrund nun festgestellter mangelnder Eignung kündigt, muss er dennoch die Karrenzentschädigung für das nachvertragliche Wettbewerbsverbot zahlen. Ein Verzicht auf ein solches nachvertragliches Wettbewerbsverbot befreit ihn – wie oben dargestellt – erst nach Ablauf eines Jahres nach Zugang der Erklärung von der Verpflichtung, diese Karrenzentschädigung zu leisten. In den ersten Monaten eines Anstellungsverhältnisses erwirbt ein Arbeitnehmer außerdem regelmäßig noch nicht ein so breites Wissen bei seinem neuen Arbeitgeber, dass sich der finanzielle Aufwand für ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot lohnen würde.
Die richtige Strategie
Ein Arbeitgeber sollte deshalb bei einer Begründung eines neuen Arbeitsverhältnisses mit einem Angestellten, mit dem er ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot abschließen will, überlegen, ob dieses nachvertragliche Wettbewerbsverbot nicht erst nach einer bestimmten Laufzeit des Vertrages in Kraft treten soll. Denkbar ist, bei einer Kündigung des Anstellungsverhältnisses innerhalb eines bestimmten Zeitraumes das nachvertragliche Wettbewerbsverbot erst gar nicht in Kraft treten zu lassen. Möglich ist auch, es aufschiebend bedingt zu vereinbaren, wobei in Formulararbeitsverträgen dann aber insbesondere keine überraschende Klausel im Sinne des § 305c Abs. 1 BGB vorliegen darf (vergl. BAG vom 13.07.2005 – 10 AZR 532/04).
Formulierungsbeispiele (nach Preis/Stoffels, Der Arbeitsvertrag, 3. Auflage, II W 10 Rz. 87):
Wird das Arbeitsverhältnis vor Ablauf der Probezeit (§ X dieses Vertrages) gekündigt, tritt das nachvertragliche Wettbewerbsverbot nicht in Kraft.
o d e r
Das nachvertragliche Wettbewerbsverbot tritt erst mit dem Zeitpunkt in Kraft, in dem Frau/Herr … die Leitung der Abteilung … (genaue Bezeichnung) übertragen bekommt und übernimmt.